IMPRESSUM | AGB | DATENSCHUTZ

PROLOG
In den nebelverhangenen Tiefen des Vergessens, als das Rad der Zeit noch nicht seinen Lauf genommen hatte, erblickte ich das verborgene Mysterium des Ursprungs. Meine Gabe erlaubt mir, durch die Schleier der Ewigkeit zu blicken, um die Geheimnisse zu entdecken, die seit undenklichen Zeiten in den Herzen der Staubgeborenen ruhen. Vor meinem inneren Auge schwebe ich über das goldene Meer des Chaos und spüre die wispernden Stimmen des Vergessens, die den Ursprung vor allen zu verbergen gedenken. Ich bewundere das ewige Spiel von Licht und Dunkelheit, das sich in den Tiefen der Leere entfaltet und beobachte die Geschwister, H’ekatee und den Dynast des Nichts, wie sie im stummen Reigen des Reifens miteinander tanzen.
Ich sehe die Wiege der Existenz, die H’ekatees unbändigem Willen entspringt, und die Trennung der Geschwister, die das Sein und das Nichts zu immerwährenden Urmächten formt. Ich beobachte H’ekatees grenzenlose schöpferische Gabe, während sie in ihren Gedanken die unendliche Vielfalt des Lebens webt. Ich fühle die schmerzliche Einsamkeit des Dynast des Nichts, der im Herzen des goldenen Meeres des Chaos zurückgelassen wurde, und ich spüre den Verlust, der sich in seinem Innersten ausbreitet.
Als Zeuge dieser Saga vermag ich die Geschichten von Hirsch und Rabe, vom Dynast des Nichts und H’ekatee zu erzählen. Ich fühle das unendliche Drama, das in den Tiefen der Zeit verloren gegangen ist, und spüre, wie es in den Herzen der Staubgeborenen weiterlebt. So erhebe ich meine Stimme, um die verborgenen Geheimnisse einer längst vergessenen Zeit zu enthüllen und lade euch ein, mit mir auf eine Reise durch die unergründlichen Weiten des Seins zu gehen, die das Nichts formen.
(Kapitel 1) Am Ende der Zeit
Am Ende der Zeit, als nichts Bestand hatte, breitete sich die unendliche Leere wie ein dichter undurchdringlicher Schleier über alles aus. Ehe Stein und Feuer ihre Kräfte entfesseln konnten, gebar sie sich in einem verzehrenden Akt der Selbstzerstörung zwei Nachkommen von unermesslicher, gegensätzlicher Macht. Diese beiden Wesenheiten, durchdrungen vom Glanz des Ursprungs, waren wie Sternenglanz und Dunkelheit, untrennbar miteinander verwoben, obwohl sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Sie tanzten miteinander in einem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Ein stummer Reigen, der sich durch die monotone Leere zog.
Äonen verstrichen wie beiläufige Wimpernschläge im sandigen Wind, während die beiden Entitäten versuchten, zueinanderzufinden, sich zu berühren und zu erfassen, verdammt zum Scheitern, denn Gegensätze ziehen sich nur an, um sich niemals zu vereinen. So folgte ein Moment, in dem alles innehielt, der Tanz eingefroren in der Unendlichkeit selbst, als eines der Wesen sich einen Namen gab, der alles verändern sollte. H’ekatee, wie sie in den folgenden Zeitaltern genannt wurde, war die Herrin des Seins, schimmernde Göttin der Schöpfung und des Lebens.
Mit der unbändigen Kraft ihres Willens erschuf H’ekatee die Existenz selbst und zwang ihren Bruder, fortan als der Dynast des Nichts bekannt, sich von ihr zu trennen. Er war dazu bestimmt, ihren Gegensatz zu bilden, die Dunkelheit, die ihr Licht umschloss, die Leere, die ihre Fülle umgab. In diesem Augenblick der Trennung erwachten die Kräfte zum Leben, und das Sein, wie wir es kennen, entstand in einem Wirbelsturm aus Feuer und Stein, einer Kaskade aus Licht, die alles erhellte und Klängen, die die Stille durchzogen.
In den Tiefen des neu erschaffenen Seins begann H’ekatee in ihrem Bewusstsein alles zu ersinnen, was jemals sein könnte, sollte und würde. Sie schloss ihre Augen und sandte ihren Gedanken, der Wunsch und Befehl zugleich war, in die Dunkelheit der unbekannten Ewigkeit, sich einen Ort vorstellend, an dem fortan das Zentrum ihrer Macht für alle Zeiten Bestand haben sollte. Dieser Ort, der im Wesen des Seins selbst liegt, ist allem und jedem innewohnend und doch nicht zu betreten oder gar zu erfassen. Dort malte sie sich in ihrer grenzenlosen Fantasie die ersten Anfänge des Lebens aus.
Sie dachte an schillernde Libellen, deren Flügel aus reinem Licht gewoben waren und die im Morgenwind tanzten. Sie stellte sich zarte Pflanzen vor, die sich im sanften Rhythmus des Mondlichts wiegten und in der Abenddämmerung leuchteten, wenn die Sterne den Himmel küssten. Ihr Geist formte uralte Bäume, deren Äste bis in die Himmelskuppel reichten und wie ein Schutzschild für die zahlreichen Geschöpfe darunter wirkten. Sie schuf kristallklare Seen, in denen sich die Träume der Sterblichen spiegelten und die Geheimnisse der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft in sich trugen. H’ekatees Gedanken schufen auch majestätische Geschöpfe, die in den unterschiedlichsten Welten alles in einem fragilen Gleichgewicht hielten, Schabernack trieben oder gar die Zerstörung verursachten, die andere zum Wiederaufbau benötigten. Vögel, die das Feuer zähmten und ihre Schwingen über die Flammenberge ausbreiteten. Pferde, die die Reinheit des Wassers verkörperten und durch die Flüsse der Welt zogen, Leben und Heilung in ihrem Kielwasser verbreitend und Füchse aus Jade, die sich von Erinnerungen ernährten und wuchsen. In späteren Träumen entstanden auch die Staubgeborenen, jene so vielfältigen und unterschiedlichen Wesen, die aus den Funken des Lebens selbst erschaffen wurden, um die unendliche Weisheit der Existenz zu ergründen und die Geheimnisse des Daseins zu entschleiern.
Als H’ekatee schließlich ihre Augen öffnete, war ihr Geist erfüllt von all den Wundern, die sie erschaffen wollte und würde. Und so begann sie mit der unbändigen Kraft ihres Willens das große Werk.
Getrennt von seiner Schwester und zurückgelassen im Herzen des Goldenen Meer des Chaos, einem ewigen Ort jenseits der Grenzen allen Seins, lebte der Dynast des Nichts. Getrübt von den Erinnerungen an H’ekatee und die Äonen, die sie gemeinsam verbracht hatten, verdüsterte sich sein Wesen. Inmitten der schimmernden Wirbel der Unordnung, die sein jetziges Reich durchzogen, erfuhr er die leidvollen Momente der sich auftürmenden Einsamkeit, die sich wie ein eisiger Dorn in seine Gedanken bohrte.

Der Dynast des Nichts schwebte durch das goldene Meer des Chaos, dessen Wellen aus reiner Dunkelheit und schimmerndem Nichts bestanden. Die raunenden Stimmen des Vergessens, die durch die endlosen Weiten seines Reiches wisperten, konnten die Sehnsucht in seinem Herzen nicht lindern. Jede schattenhafte Gestalt, die aus den Tiefen des Chaos hervorbrach, erinnerte ihn an das Licht, das einst in seiner Welt geleuchtet hatte, als er und seine Schwester noch untrennbar miteinander verwoben gewesen waren. Mit traurigen Augen blickte er in die Ferne, wo die Grenzen seines Reiches in den Schleiern der Realität verschwanden. Die Erinnerung an H’ekatees strahlendes Antlitz und das leise Flüstern ihrer Stimme, das einst seine Gedanken durchdrungen hatte, ließ sein Innerstes erbeben. Doch nun, getrennt durch die unüberbrückbare Kluft zwischen Sein und Nichts, schien die Wärme ihrer Gegenwart für immer verloren.
In seiner unendlichen Tristesse begann der Dynast des Nichts, die dunklen Ströme des Chaos zu formen und zu lenken, um seiner Einsamkeit eine Gestalt zu verleihen. So rief er Schattenwesen in das Reich, die seine Stille mit ihrer Anwesenheit zu teilen wussten. Doch selbst die Geschöpfe, die er aus den Abgründen des Nichts hervorlockte, konnten die Leere in seinem Herzen nicht füllen, die Sehnsucht nach der verlorenen Gemeinschaft. So verharrte er in seinem goldenen Meer des Chaos, gepeinigt von der Erinnerung an das Licht, das einst sein Leben erhellte, und sehnte sich nach der Geborgenheit von H’ekatees Nähe.
Die beiden Geschwister, auf ewig verbunden und doch getrennt, wurden zu den immerwährenden Urkräften des Seins und des Nichts. Und so beginnt die Saga von Hirsch und Rabe, die Geschichte von H’ekatee und dem Dynast des Nichts, ein unendliches Drama, das sich in den Tiefen der Zeit verlor, um in den Herzen der Staubgeborenen nachzuklingen.
(Kapitel 2) Die Aspekte der Ewigen
In der Unendlichkeit des Seins, als H’ekatees Gedanken sich in ihrer grenzenlosen Weitsicht zu entfalten begannen, erkannte sie, dass sie die gewaltige Verantwortung für die Schöpfung und den Erhalt der Existenz nicht allein tragen konnte. So beschloss sie, aus der Quelle ihres göttlichen Wesens Kinder zu schöpfen, die ihr zur Seite stehen sollten.
In einem Akt bedingungsloser Hingabe und unvergleichlicher Macht berührte H’ekatee das Herz des Seins und rief ihre Kinder aus sich heraus in die Existenz. Aus dem Schimmer ihres Glanzes und dem Odem ihrer Macht bildeten sich Gestalten, die zunächst in Schatten gehüllt waren und noch keine feste Form besaßen. Sie waren die Aspekte der Ewigen, die Verkörperungen ihrer unzähligen Facetten, die all ihre Wünsche und Ängste, ihre Hoffnungen und Sehnsüchte widerspiegelten.
Nacheinander erwachten sie und lauschten der Göttermutter, die ihnen mit sanfter Stimme und liebevoller Weisheit offenbarte, was zu tun war. H’ekatee sprach zu ihnen von der Verantwortung, die sie tragen würden, und den Aufgaben, die vor ihnen lagen. Sie erklärte, dass sie alle miteinander verbunden und ihre Schicksale untrennbar voneinander waren, um das fragile Gleichgewicht der Existenz zu erhalten. Sie sollten sich vor Zwietracht und Fehden untereinander hüten und nichts höher stellen als das Sein selbst. Sie verstanden, dass sie Teil eines größeren Plans waren und dass ihnen eine besondere Rolle bei der Erschaffung und Erhaltung des Seins zukam. Die Kinder H’ekatees, allmächtig und einzigartig, besaßen besondere Fähigkeiten und Verantwortungsbereiche, die ihre göttliche Mutter ihnen zugedacht hatte. Diese würden sich ihnen zu gegebener Zeit offenbaren.
Sie lauschten den Worten H’ekatees, die ihnen von der Schönheit und Vielfalt des Seins erzählte, das sie in ihren Gedanken erschaffen hatte. Sie hörten von den verschiedenen Kräften, die in einem ständigen Miteinander und Gegeneinander den übergeordneten Kreislauf bildeten, von Staub, Äther und Zeit, von den unzähligen Welten, die darauf warteten, von ihnen geformt und behütet zu werden, und sie zitterten zunächst bei dem Gedanken, Verantwortung übernehmen zu müssen. H’ekatee erkannte das Zögern ihrer göttlichen Kinder und schenkte ihnen Mut und Tatendrang, Neugier und Ludus, die sie befähigen würden, die vor ihnen liegenden Herausforderungen zu meistern.

Eine lange Zeit lauschten sie ihrer göttlichen Mutter in ehrfürchtiger Ergebenheit und erkannten, dass es ihre Bestimmung war, ihr bei der Wahrung des Seins beizustehen. Sie wussten, dass ihnen bald Namen und Gestalt gegeben würde, die sie als Kinder H’ekatees auszeichnen, um ihre besondere Bedeutung im großen Plan der Seins Ordnung zu verdeutlichen. Und so begannen sie, sich auf die vor ihnen liegenden Aufgaben vorzubereiten, und warteten geduldig darauf, dass ihre Mutter ihnen ihre wahren Namen und Gestalten offenbarte.
In der Zwischenzeit webte H’ekatee weiter an ihrem kosmischen Entwurf und schuf die Grundlagen für die unzähligen Welten und Geschöpfe, die ihre Kinder bevölkern, führen und beschützen sollten. Beim Gedanken an all das, was sein würde, lief ihr manchmal eine Träne über die Wange, tropfte von ihrem Kinn und verwandelte sich in einen Kometen, der den Raum zwischen den Räumen durchquerte. Voller Stolz und Liebe beobachtete sie, wie ihre Nachkommen im Schutz ihrer wärmenden Gegenwart miteinander interagierten und ihre eigenen einzigartigen Persönlichkeiten und Kräfte entdeckten. Einige überragten die anderen, manche blieben unscheinbar, und andere verhielten sich zurückhaltend, als sei der richtige Zeitpunkt für ihr Handeln noch nicht gekommen. Doch jedes der Kinder war genau so, wie H’ekatee sie sich vorgestellt hatte.
Als das große Werk vorerst vollbracht war, rief H’ekatee ihre Kinder zu sich und offenbarte ihnen ihre wahren Namen und Gestalten. Sie sprach zu jedem von ihnen, wie man zu einem geliebten Kind spricht, und enthüllte die wahre Essenz ihrer göttlichen Natur. Bei jedem Namen, den sie aussprach, leuchteten die Kinder in den Farben des Universums und nahmen die Formen an, die ihrer Wesensart und ihrer Bestimmung am besten entsprachen. Die Namen der Götterkinder waren die ersten Worte, die ausgesprochen wurden, und als dies geschah, vibrierte das Sein selbst unter den Klängen einer Wahrheit, die mit dem Wesen der Schöpfung verbunden war und für immer bleiben sollte.
Mit ihren wahren Namen und Gestalten ausgestattet, waren die Kinder H’ekatees nun bereit, ihre Aufgaben in der Schöpfung und der Erhaltung der Seins zu übernehmen. Sie verneigten sich ehrfürchtig vor ihrer göttlichen Mutter und dankten ihr für das Leben und die Bestimmung, die sie ihnen geschenkt hatte.
Dann entschwanden die Götter wie ein Schwarm funkelnder Sterne in die unendlichen Weiten des Universums, um ihre Pflichten zu erfüllen und die Welt nach den Wünschen ihrer göttlichen Mutter zu gestalten und zu erhalten. Und so begann das Zeitalter der Aspekte der Ewigen, in dem die Kinder H’ekatees ihre Aufgaben in der Schöpfung und der Erhaltung der Existenz übernahmen und die wunderbare Vielfalt des Lebens erblühen ließen.
(Kapitel 3) Das Erwachen der Träume
Als er von der großen Göttermutter seine wahre Gestalt und seinen Namen erhalten hatte, fühlte Lavok, der Gott der Träume und der Hellsichtigkeit, eine tiefe Neugier in sich aufsteigen. Er hatte das Gefühl, dass ihm eine besondere Aufgabe zu Teil wurde: die Herrschaft über die Welt der Träume. Noch unberührt von seiner göttlichen Hand, wartete sie darauf, von ihm gestaltet und belebt zu werden.
Mit kindlicher Faszination und Vorfreude näherte sich Lavok der Schwelle zur Traumwelt. Noch hatte er nur eine vage Vorstellung von dem, was ihn dort erwarten würde, aber er spürte, dass es sich um einen Ort der unendlichen Möglichkeiten handeln würde, an dem er seine Kraft und seine Kreativität zum Ausdruck bringen konnte. Als er zum ersten Mal in die Traumwelt eintrat, war sie noch ein endloser, karger und gestaltloser Raum, der sich vor ihm ausdehnte. Die Welt der Träume war wie ein großer, unbeschriebener Ozean, der darauf wartete, von seiner Fantasie und seinen Visionen durchquert zu werden. Die blassen Farben und formlosen Schemen, die in dieser Welt lauerten, schienen zu flüstern und auf seine Berührung zu warten. Lavok fühlte eine Mischung aus Ehrfurcht und Erregung inmitten dieser unendlichen Weite. Er war sich der ungeheuren Verantwortung bewusst, die auf ihm lastete, und gleichzeitig war er berauscht von dem Gedanken, dass er allein es in der Hand hatte, alles nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Tief durchatmend, ließ er seine Gedanken und Empfindungen durch die formlose Traumwelt strömen. Er spürte, wie seine göttliche Präsenz die Welt zu verändern begann und wie sie auf die Berührung seines Geistes reagierte, als ob sie nur darauf gewartet hätte, von ihm in Besitz genommen zu werden. Die zuvor verborgenen Schatten und Farben begannen sich zu winden, zu bewegen und zu wirbeln, als wären sie lebendige Wesen, die seine Gegenwart freudig begrüßten.

In einem Moment der Offenbarung wurde Lavok klar, dass die Welt der Träume nicht nur ein Ort der unendlichen Möglichkeiten war, eine Leinwand, die er nach Belieben bemalen konnte, sondern dass sie vor allem auch ein Spiegel seiner selbst war. Er spürte, dass er hier seine tiefsten Ängste und Sehnsüchte, seine wildesten Fantasien und seine hellsten Visionen ausdrücken konnte. Hier war er in der Lage, sich eine Welt zu erschaffen, in der alles möglich war und in der er sich völlig frei und ohne Rücksicht auf andere entfalten konnte.
Mit neuem Mut und fester Entschlossenheit machte sich Lavok daran, die Domäne des Traums zu formen und zu einem Ort der Wunder und Fantasmen zu machen. Er wusste, dass es an ihm lag, den Träumenden, die noch folgen sollten, einen Raum zu geben, in dem sie ihre eigene Seele erforschen und die Grenzen ihrer Vorstellungskraft überschreiten konnten. Einen Ort, an dem sie über sich hinauswachsen oder in sich zusammenfallen würden. Und so begann Lavoks Schöpfungswerk in der Welt der Träume, die den Grundstein für unzählige Abenteuer und Entdeckungen legen sollte.
Er webte die unterschiedlichsten Landschaften und Szenarien, die von den atemberaubendsten Wundern bis zu den dunkelsten Albträumen reichten. Hier entstanden majestätische Paläste, bewohnt von Ziegen, die aus Sternenlicht Kämme webten, und verwunschene Wälder, bevölkert von singenden Tannenzapfen. Gewundene Labyrinthe und endlose Ozeane, die von Träumern bevölkert und erforscht wurden. Im Herzen seines Reiches errichtete er eine gigantische Zitadelle, die alles überragte. Düster wuchs sie wie ein schwarzer Dorn aus der bunten und vielfältigen Umgebung. Im Inneren der Zitadelle entstand ein Saal, der von gigantischen Säulen gestützt wurde, die so hoch waren, dass sich ihr Ende in der Schwärze der Ferne verlor. In der Mitte des Saales stand ein Thron, schlicht und erhaben. Auf ihm sitzend, betrachtete der ewige Träumer sein Werk und wartete auf die Ankunft seiner Brüder und Schwestern.
(Kapitel 4) Die Launen eines kindlichen Gottes
Tage vergingen, Wochen verstrichen, Jahreszeiten wiederholten sich, und Lavok wartete geduldig auf die Ankunft seiner göttlichen Geschwister. Doch keiner von ihnen betrat seine Welt der Träume. Die Einsamkeit begann an ihm zu nagen und seine Gedanken verirrten sich. Die unendlichen Möglichkeiten der Traumwelt wurden zur Bürde und sein kindliches Wesen gewann die Oberhand.
In einem Anfall von Langeweile und Unzufriedenheit begann Lavok, seine Welt auf den Kopf zu stellen. Er ließ Berge zerbersten und schuf riesige Schluchten, aus denen bizarre, unberechenbare Kreaturen hervorkrochen. Die einst friedlichen Wälder wurden von stürmischen Winden gepeitscht, die Äste knickten und Bäume entwurzelten. Die Ozeane, die er geschaffen hatte, begannen zu toben, und gewaltige Flutwellen überrollten die Küsten, die er einst so sorgfältig modelliert hatte. Die sonst so fröhlichen und verspielten Bewohner der Traumwelt spürten den Zorn und die Verzweiflung ihres Gottes und versteckten sich in ihren Zufluchtsorten. Sie fürchteten Lavoks Zorn und wussten nicht, wie sie ihm helfen oder ihn besänftigen konnten. Die Welt der Träume, einst ein Ort der Freude und der Entdeckungen, verwandelte sich in ein chaotisches Durcheinander tobender Kräfte und zorniger Kreaturen.
Doch inmitten dieser Zerstörung bemerkte Lavok eine kleine, funkelnde Erscheinung, die sich furchtlos seinem Sturm entgegenstellte. Es war ein winziger Schmetterling, dessen Flügel in allen Farben des Regenbogens schillerten. Trotz der tosenden Winde und der zerstörerischen Kräfte, die Lavok entfesselt hatte, flog das zarte Geschöpf unbeirrt auf ihn zu.
Als der Schmetterling schließlich vor Lavok landete, verwandelte er sich in eine flüsternde Stimme, die direkt in sein Herz sprach: „Warum zerstörst du, was du mit so viel Liebe und Hingabe erschaffen hast? Die Welt der Träume ist deine Schöpfung und es ist deine Aufgabe, sie zu beschützen und zu erhalten.“
Lavok erkannte die Weisheit in den Worten des Schmetterlings und spürte, wie seine Wut und Verzweiflung langsam schwanden. Er beschloss, sein Reich in den Zustand zu versetzen, in dem es einst gewesen war, und ihm die Schönheit und Harmonie zurückzugeben, die er in seiner Kreation geschaffen hatte. Mit neuem Mut und Entschlossenheit schwor er sich, der Welt der Träume eine neue Ordnung und Stabilität zu geben, um sie vor den Launen eines einsamen Gottes zu schützen.
(Kapitel 5) Das Volk der Götter
Eine besondere Gabe, die Lavok von seiner Mutter H’ekatee erhalten hatte, erwachte in ihm, nachdem er seine Traumwelt wiederhergestellt hatte. Sie befähigte jedes der Götterkinder, als einmaligen, unwiederholbaren Akt ein eigenes Volk zu erschaffen und die Schöpfung zu bereichern.
Inspiriert von dieser Gabe machte sich Lavok daran, seinen ersten Olnathron zu erschaffen. Er durchstreifte die Welt der Träume auf der Suche nach etwas Einzigartigem, das seinem ersten Diener Gestalt verleihen würde. Schließlich stieß er auf einen schimmernden Nebel, der von den Farben und Schatten der Träume erfüllt war. Er wusste, dass er das perfekte Material für seinen Diener gefunden hatte.
Vorsichtig berührte Lavok den Nebel, um die Essenz des Nebels mit seiner göttlichen Energie zu vereinen. Er spürte, wie das Material unter seinen Fingern pulsierte. Langsam nahm es Gestalt an. Farben und Schatten verschmolzen zu einem filigranen und kraftvollen Körper, der die Gestalt des Olnathron annahm. Zutiefst berührt von der Lebensenergie, die da zum Vorschein kam, füllten sich Lavoks Augen mit Tränen.
Als der erste Olnathron schließlich vor ihm stand, betrachtete ihn Lavok voller Stolz und Zuneigung. Er sah in ihm nicht nur das Ergebnis seiner göttlichen Macht, sondern auch das Echo seiner eigenen Sehnsucht nach Verbundenheit und Verständnis. Lavok legte seine Hand auf die Brust des Olnathron und spürte, wie ihre Herzen im Einklang schlugen.

Liebevoll sprach Lavok zu seinem Geschöpf: „Du bist der erste Olnathron, der erste von vielen, mein treuer Diener und Gefährte. Du wurdest aus der Essenz der Träume und meiner göttlichen Energie erschaffen. Du wirst mir helfen, die Träume der Welt zu weben und zu formen. Du bist ein Teil von mir und ich werde immer bei dir sein“.
Der Olnathron verstand die Worte seines Schöpfers und nickte ehrfürchtig. Er fühlte die tiefe Verbundenheit, die ihn mit Lavok verband, und schwor, ihm mit bedingungsloser Treue und Hingabe zu dienen. In seinen Augen stand die Entschlossenheit, alles zu tun, um den Willen seines Gottes zu erfüllen.
In diesem Moment erfüllte Lavok ein Gefühl der Zufriedenheit und des Friedens. Er wusste, dass er mit der Erschaffung des ersten Olnathron den Grundstein für eine Welt gelegt hatte, in der er sich nicht mehr allein und verlassen fühlen würde. Gemeinsam würden sie die Träume der Welt zum Leben erwecken und unzählige Geschichten und Abenteuer erschaffen, die die Seelen der Träumenden berühren und verwandeln würden.
Die Olnathryn, Lavoks Volk, waren dazu bestimmt, die Träume aller Wesen zu weben, die in der Lage waren, sie zu empfangen. Sie waren Meister der Imagination und verwandelten die Gedanken und Wünsche der Träumenden in faszinierende und wundersame Bilder und Geschichten. Sie dienten ihrem Vater Lavok mit bedingungsloser Hingabe und folgten seinen Anweisungen, ohne dabei seinen Willen infrage zu stellen. Obwohl sie nicht die mächtigsten Geschöpfe der zweiten Schöpfung waren, besaßen sie eine Schnelligkeit und Geschicklichkeit, die sie allen anderen ebenbürtig machte. Sie konnten sich fast unsichtbar durch die Traumwelt bewegen und dort agieren, ohne je von den Träumenden bemerkt zu werden. In ihrer Arbeit waren sie so flink und effizient, dass sie in einem Augenblick unzählige Träume weben konnten.
Lavok war stolz auf seine Schöpfung und sah in den Olnathryn die perfekte Ergänzung zu seiner Traumwelt. Mit ihrer Hilfe würde er die Traumwelt weiter ausbauen und verfeinern, um sie zu einem Ort zu machen, an dem sich die Träumer verlieren und wiederfinden konnten. Und obwohl er wusste, dass auch seine Geschwister eines Tages ihre eigenen Völker erschaffen würden, war er zufrieden mit dem Wissen, dass die Olnathryn einzigartige Geschöpfe waren, die seine Traumwelt auf eine Weise bereicherten, die kein anderes Volk je erreichen würde.
So begann die Ära der Olnathryn in der Domäne ihres Herrn, die stets im Schatten ihrer Schöpfung wirkten und die Träume der Welt webten. Ihr Einfluss erstreckte sich über die gesamte Traumwelt, und ihre unermüdliche Schaffenskraft trug dazu bei, die Träumer zu berühren und ihnen Trost, Hoffnung, Erkenntnis und manchmal auch Verzweiflung zu schenken.
In der Gesellschaft der Olnathryn fand Lavok endlich die Verbundenheit und das Verständnis, nach dem er sich so sehr gesehnt hatte. Er war nicht mehr allein in seiner Traumwelt, sondern umgeben von treuen Dienern und Spielgefährten, die seine Sehnsucht teilten und ihm halfen, die Träume der Welt zu einem Ort voller Wunder zu machen.
(Kapitel 6) Die Welt der Staubgeborenen
Fewalue, Tochter von H’ekatee und Herrin der Elemente, betrat als erste der Götterkinder die noch junge und unberührte Welt der Staubgeborenen. Sie besaß die Gabe, Feuer, Wasser, Luft und Erde gleichermaßen zu beherrschen und nach ihrem Willen zu lenken. Ihre Anmut und Pracht waren überwältigend und spiegelten ihre Unschuld und die Harmonie wider, die sie in die Welt zu bringen vermochte.
Die erstarrten Elemente, die bereits von H’ekatee in diese Welt gesandt worden waren, spürten ihre Gegenwart und wurden von der jungen Göttin angezogen wie Motten vom Licht. Die Flammen des Feuers begannen leidenschaftlich zu tanzen und entfachten in ihrer Gegenwart einen Sturm aus Funken, während die Wellen des Wassers sich sanft kräuselten, um ihre Ehrfurcht auszudrücken und sich wie ein ruhiger Spiegel zu präsentieren, in dem sich Fewalue betrachten konnte. Die wilden Winde wurden zu einem zarten Hauch, der ihr Haar sanft flattern ließ und ihr in stiller Andacht lauschte. Selbst die Erde, so fest und unerschütterlich sie auch sein mochte, schien in Fewalues Gegenwart zu beben und sich zu beugen, als wolle sie sich ihrer Herrin unterwerfen.
Alle Elemente ordneten sich augenblicklich Fewalue unter, bereit, ihre Wünsche und Gedanken zu erfüllen und ihr zu gefallen. Sie erkannten in ihr eine Göttin, die das Gleichgewicht zwischen ihnen zu wahren vermochte, und verehrten sie für ihre Sanftmut und Harmonie.

Gemeinsam führten die Elemente Fewalue durch ihre junge, wilde Welt und zeigten ihr die Schönheit, die sie in ihrer unberührten Form besaßen. Doch trotz ihrer Verehrung für die Göttin entbrannte zwischen den Elementen Streit, denn jedes Element buhlte um die Gunst Fewalues. Mit Sanftmut und Verständnis schlichtete Fewalue die Zwistigkeiten und wies darauf hin, dass wahre Harmonie nur durch das Zusammenspiel und die gegenseitige Rücksicht der Elemente untereinander erreicht werden könne.
So begann Fewalue mithilfe der Elemente der Welt der Staubgeborenen eine Form zu geben. Sie hob ihre Arme, und die Erde bäumte sich auf ihren Befehl hin zu majestätischen Bergen und sanften Hügeln auf. Sie senkte ihre Hände, und die Täler formten sich, um ihr eine Stätte der Ruhe und Einkehr zu bieten. Die Erde folgte ihren Bewegungen wie ein gelehriger Schüler und nahm die Gestalt an, die Fewalue ihr gab. Die Meere entstanden, als Fewalue mit einem sanften Lächeln das Wasser küsste. Die Wellen tanzten aufgeregt und formten sich zu gewaltigen Ozeanen und stillen Seen, die sich über die Welt der Staubgeborenen ausbreiteten. In ihnen spiegelte sich der Himmel, den Fewalue durch die Essenz der Luft geformt hatte und der sich wie ein schützender Mantel über die Welt legte. Das Feuer, das Fewalue so leidenschaftlich verehrte, fand seinen Platz als glühender Kern im Herzen der Weltenlohe. In einem hitzigen Bersten entsprangen aus ihm die ersten hellen Funken, die allgegenwärtige Dunkelheit durchdringend und die Weite mit einem warmen Schein erhellend.
Alles lag bereit, doch verharrte es regungslos und starr. Jedes Element hatte seine Domäne erschaffen, doch fehlte die Verbindung untereinander. Die Göttin betrachtete ihr Werk und ließ ihre Gedanken schweifen. Vor ihrem inneren Auge tanzten Lichter aus Sternenglanz, und die Stimme der Göttermutter H’ekatee wisperte sanft: „Das Equilibrium, mein Kind. Gewähre dem Land deine Gunst, und das Land wird dir die seine schenken.“
Fewalue blickte auf und beobachtete wie Wellen das Land umtosten, bestrebt, es abzutragen, während Flammen auf den Gebirgskronen die Luft verschlangen, um zu wachsen. In diesem Moment eröffnete sich ihr eine tiefere Erkenntnis über den ewigen Kreislauf und die untrennbare Abhängigkeit der Elemente voneinander. Sie erkannte, dass das Gleichgewicht, welches die Welt erfüllt, in der gegenseitigen Nahrung und Begrenzung ihrer Kräfte liegt, wie der Fluss, der die Erde formt, und das Feuer, das von der Luft genährt wird, nur um sie wiederum zu verwandeln.
Sie nickte und lächelte, denn sie hatte verstanden. Sie erkannte das Geheimnis, das in der Harmonie der Elemente verborgen lag, und wusste nun, dass sie ihre Schöpfung zum Leben erwecken musste, indem sie ihnen die Chance gab, einander zu stärken und zu zähmen. Inmitten dieser ungezähmten Wildnis natürlicher Unordnung verlieh Fewalue ihrem Wirken den göttlichen Hauch der Harmonie. Sie versammelte Feuer, Erde, Wasser und Luft um sich und webte ein unvergängliches Geflecht, das ewig zwischen den Elementen verweilen würde, als dauerhaftes Gelöbnis und Erinnerung zugleich.
Fewalue berührte das Feuer und entfachte Flammen, die im Farbenspiel des künftigen Sonnenuntergangs tanzten, den sie in den Erinnerungen ihrer Mutter erblickt hatte. Mit Wärme und Leidenschaft füllte das Feuer die Welt mit Licht und Leben, glimmend in den Tiefen der Erde und züngelnd auf den Berggipfeln, während es von der Luft genährt wurde und ihr im Gegenzug Wärme schenkte. In Harmonie flossen Meere und Flüsse, als Fewalue das Wasser berührte. In unzähligen Gestalten und Farbnuancen offenbarte das Wasser seine Reinheit und Wandlungsfähigkeit. Es sammelte sich in stillen Seen, die wie Spiegel Himmel und Welt reflektierten, rauschte in reißenden Bächen und gewaltigen Wasserfällen, die Umgebung mit Energie erfüllend, während es die Erde formte und nährte. Mit Fewalues Berührung der Erde erbebte die Welt der Staubgeborenen erwachend in ganzer Pracht und Vielfalt. Der ewige Stein offenbarte seine Stärke und Beständigkeit in gewaltigen Bergen, die majestätisch emporragten, und seine Sanftheit in geschwungenen Hügeln und weiten Ebenen, die gleich einem Teppich die Welt umhüllten. Die Erde bot den anderen Elementen Halt und Stabilität, während sie gleichzeitig deren Einflüsse annahm und sich wandelte. Zuletzt berührte Fewalue die Luft und ließ die majestätischen Winde durch die Welt wirbeln, ihre Freiheit und Unberechenbarkeit offenbarend, in zarten Brisen wehend und mächtigen Stürmen brausend. Die Luft trug den Duft von Mysterien und Geheimnissen ferner Länder und flüsterte Geschichten von unentdeckten Orten, die erst später erwachen sollten. Sie vereinte die anderen Elemente, trug die Feuchtigkeit des Wassers und die Wärme des Feuers, während sie die Erde erfrischte und belebte.
Als Fewalue ihr Werk vollendet hatte, stand sie auf einem Gipfel und betrachtete die Welt, die sie mithilfe der Elemente erschaffen hatte. Sie sah den Kreislauf und die Harmonie ihrer Schöpfung und wusste, dass sie bereit war für die sterblichen Geschöpfe, die noch kommen würden.
Zu ebendieser Zeit, da alles vollbracht war, erfüllte die Elemente eine tiefe Sehnsucht, in der Nähe der Göttin zu verweilen und ihr zu dienen, ohne ihre Pflichten in der Welt zu vernachlässigen. Fewalue erkannte diesen Wunsch und webte aus der Essenz jedes Elements ihr eigenes Volk, die Tuiulalagos. Diese facettenreichen Geschöpfe trugen die Attribute der Elemente in sich, ob von Flammen umschlungen wie das leidenschaftliche Feuer oder flüchtig wie der wilde Ostwind, die Ungebundenheit der Luft verkörpernd.
Die Tuiulalagos wurden Fewalues treue Gefährten und Helfer in der Welt der Staubgeborenen. Sie wahrten die Harmonie zwischen den Elementen und trugen dazu bei, die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung zu erhalten. Ihre Gegenwart war ein lebendiges Symbol der tiefen Verbindung zwischen Fewalue und den Elementen, deren Essenz sie fortan ganz nah an ihrem Herzen trug.
(Kapitel 7) Die Saat des Lebens
Barador, das Kind H’ekatees und Bruder Fewalues, betrat das von seiner Schwester und den Elementen gewebte Reich, als die Welt der Staubgeborenen ihre endgültige Gestalt angenommen hatte. Seine gottgleiche Gestalt zeugte von unbändiger Geduld und Umsicht, sie vereinte einen menschlich anmutenden Körper mit dem Panzer einer uralten Schildkröte. Sein Haar, aus rankenden Lianen geformt und von flüchtigen Irrlichtern bewohnt, tanzte sanft im Wind, während seine wurzelartigen Füße bei jedem Schritt tief in die Erde eindrangen, in ständiger Verbindung mit dem Leben, das er in dieser Welt erwecken sollte.
Seine Gegenwart ließ die Welt der Staubgeborenen erbeben, und eine unvergleichliche Energie durchströmte die Lüfte, als er seinen ersten Schritt auf die fruchtbare Erde setzte. Fewalue, seine Schwester, erwartete ihn mit offenen Armen und führte ihn durch die noch unberührte Welt, die sie gemeinsam mit den Elementen geformt hatte. Ihre Augen glänzten vor Stolz und Erwartung, als sie ihrem Bruder die prächtigen Berge, die kristallklaren Seen und die sanften Hügel zeigte, die darauf warteten, mit Leben erfüllt zu werden.

Mit einem tiefen, hallenden Ton rief er das erste Kapitel des Lebens herbei. Auf den endlosen Ebenen sprossen saftige Gräser aus dem Boden. Zeitlose Wälder wuchsen in die Höhe und breiteten ihre Äste aus, wie die Arme eines geliebten Freundes, der einen in die Umarmung der Natur zieht. Rankende Kletterpflanzen umschlangen die Bäume und streckten ihre zarten Fäden in alle Richtungen aus, wie auf der Suche nach Wärme und Licht. Blüten in allen Farben entfalteten sich in einem prachtvollen Schaubild, und ihr süßer Duft betörte die Luft, die fortan von einem verführerischen Bouquet von Wohlgeruch durchtränkt war.
Nachdem er das Pflanzenreich erschaffen hatte, wandte sich Barador der Tierwelt zu und ließ sie entstehen. In einer symphonischen Explosion des Lebens entfesselte er die ganze Vielfalt der tierischen Kreaturen, die diese Welt bevölkern sollten. Majestätische Hirsche mit imposanten Geweihen wuchsen aus der Erde, schlanke Gazellen trippelten elegant durch die Waldschneisen. Im Schatten der Bäume huschten scheue Hasen und neugierige Marder umher, während sich Raubkatzen lautlos an ihre Beute heranschlichen.
Die Gewässer der Welt wurden zum Schauplatz eines neuen Kapitels des Lebens, als Barador die Fische ins Dasein rief. Farbenprächtige Schwärme glitten durch die Tiefen der Ozeane und Flüsse, während gewaltige Meeresungeheuer ihre langen Tentakel und Flossen in die Dunkelheit hinausstreckten. An der Oberfläche tanzten verspielte Delfine in den Wellen, und riesige Wale durchbrachen die Wasseroberfläche, um den Himmel zu besingen.
Schließlich erhoben sich die Vögel in die Lüfte, als Barador seine Schöpfung vervollständigte. Bunte Scharen schillernder Vögel, die in den grellsten Farben leuchteten, füllten den Himmel und entfachten ein Crescendo aus Gesängen und Geschrei. Majestätische Raubvögel zogen hoch oben ihre Kreise, während kleine Singvögel in den Baumkronen ihre Melodien trällerten.
Barador betrachtete das entstandene Leben und lächelte zufrieden. Die Pflanzen und Tiere, die er hervorgebracht hatte, bildeten ein ausgewogenes Ganzes, in dem jedes Geschöpf seinen Platz in der Welt gefunden hatte. Doch er wusste, dass er auch sein Volk erschaffen musste, um die natürliche Ordnung und den Kreislauf des Lebens zu bewahren.
Im Bewusstsein der großen Verantwortung, die auf seinen Schultern lastete, beschloss Barador, dass es an der Zeit war, die Saat des Lebens in die Welt der Staubgeborenen zu säen. In einer kraftvollen Geste schlug er seine Wurzelfüße tief in die Erde und entfesselte die geballte Wucht seines ganzen Selbst. Wie ein gewaltiger Strom purer Lebensenergie durchzog seine Schaffenskraft die Welt, und eine wogende Welle von pulsierendem Grün ergoss sich über alles.
Barador stand am Rande eines tiefen Waldes, dessen Blätterdach das Licht in einem silbernen Schleier einfing. Die Welt, die er geschaffen hatte, war von atemberaubender Schönheit, doch sein Herz pochte unruhig in seiner göttlichen Brust. Die Pflanzen und Tiere, die er so sehr liebte, kämpften erbittert ums Überleben. Obwohl er wusste, dass dies ein natürlicher Teil des Kreislaufs des Lebens war, sehnte er sich danach, ein Gleichgewicht in dieser Welt zu finden, damit alle Geschöpfe in Harmonie leben konnten.
Während er in den Schatten der Bäume blickte, bemerkte er einen kleinen, unschuldigen Hasen, der in der Dunkelheit bebte. Die Zeit schien für einen Moment stillzustehen, bevor ein hungriger Fuchs aus dem Unterholz stürzte und das zitternde Tier verschlang. Baradors Herz zog sich schmerzhaft zusammen, als ihm bewusst wurde, wie zerbrechlich die Balance der Natur war. In diesem Augenblick der Klarheit erkannte er, dass die Welt der Staubgeborenen noch Wesenheiten benötigte, die in der Lage waren, Ordnung und Ausgleich zu bringen und die zarte Harmonie der Schöpfung zu bewahren. Er beschloss, ein Volk zu erschaffen, das sowohl klug als auch mitfühlend sein sollte, um den Pflanzen und Tieren zu helfen, in Eintracht miteinander zu leben.
Mit einer Liebe, die so grenzenlos war wie das Meer und so tief wie der Nachthimmel, formte Barador sein Volk. Aus den Tiefen der Erde und dem Odem des Lebens schuf er ihre Körper, so vielfältig und wunderschön wie die Farben eines Regenbogens. Er hauchte ihnen seine Seele ein und liebte jeden Einzelnen von ihnen mit einer Intensität, die selbst die Sterne erstrahlen ließ. Barador machte ihnen ein einzigartiges Geschenk, das ihnen die Macht geben sollte, den Einklang allen Lebens zu bewahren: Als einziges Volk unter den verschiedenen Völkern der Götter ermöglichte er ihnen, sich fortzupflanzen. In dieser Gabe sah er die Möglichkeit, dass sein Volk wachsen und gedeihen könnte, um die Balance der Natur aufrechtzuerhalten.
Baradors Volk, die Eredh‘tir genannt wurden, waren tief bewegt von der unermesslichen Liebe ihres Schöpfers, schworen ihm ewige Treue und versprachen, ihre Pflichten mit Weisheit und Hingabe zu erfüllen. Sie verteilten sich über die Welt der Staubgeborenen und begannen, die Wälder und Felder zu pflegen, den Tieren zu helfen und die zarte Balance zu wahren. Und so fand das pulsierende Leben in die Welt der Staubgeborenen und wartete auf die Ankunft derer, die von der großen Göttermutter H’ekatee angekündigt worden waren.
(Interkalar)
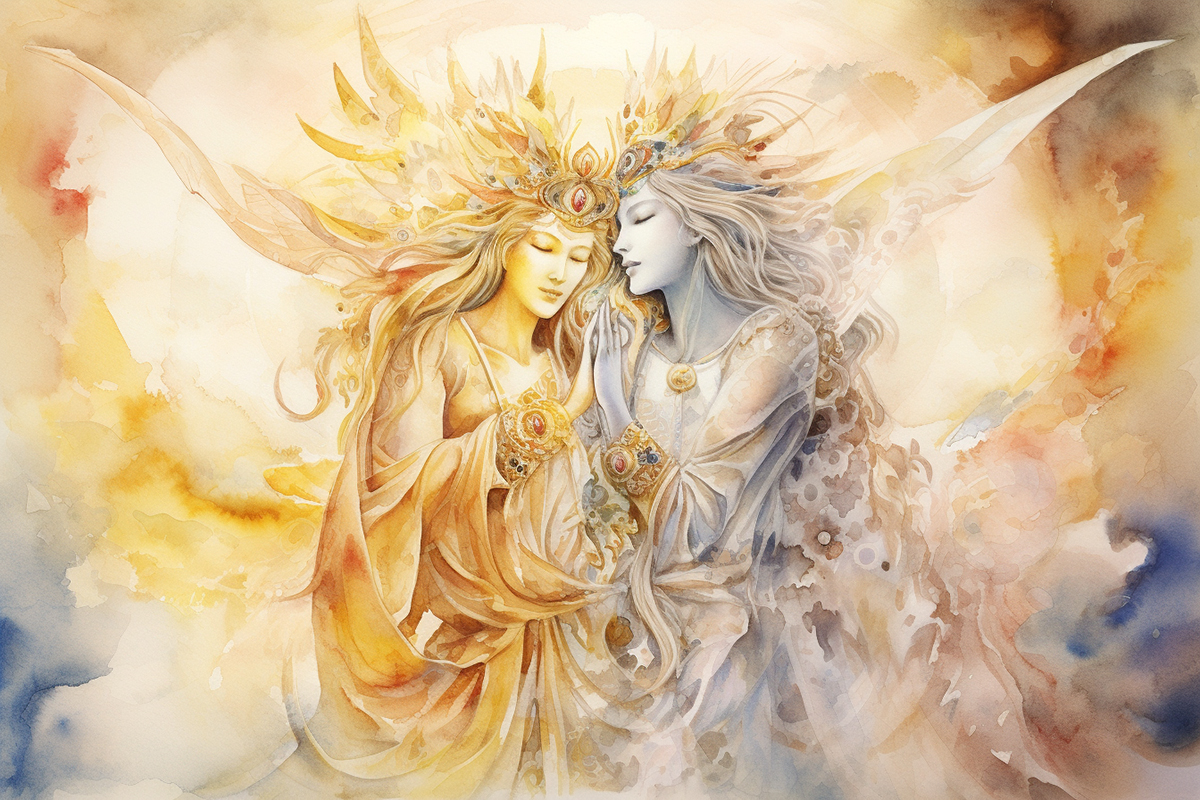
In ew’gen Schatten einst verborgen,
Traf Calan auf Nuir, die Nacht.
Durch Licht und Dunkelheit geborgen,
Hat ihre Lieb‘ Wunder vollbracht.
Calan, der strahlend güld’ne Stern,
Erleuchtet jeden Winkel weit.
Nuir, der Mond, ihr Antlitz zag,
Gewährt den Suchenden Geleit.
Sie reisen, ewig Seit‘ an Seite,
In endlos Schönheit, Glanz und Pracht.
Gemeinsam weben sie die Leite,
Von Licht und Schatten, Tag und Nacht.
In jener Reise, zeitlos, zart,
Vereint in Liebe, Glanz und Schein,
Berührn sie sich, so offenbart,
Ein stummer Ring die Seelenpein.
Doch wenn sie sich, in Liebe nahe,
Berühren, halten, inniglich,
Dann sinkt die Welt in tiefe Schatten,
Verschlingt einen Moment das Licht.
Und dann, so schnell wie es begonnen,
Erwacht aufs Neue Glanz und Schein,
Zwei Liebende, von Ewigkeiten,
Vereint in ihrem Weg, allein.
(Kapitel 8) Die Andere Seite der Medaille
In den Wirbeln der Ewigkeit, wo das Rad der Zeit stillzustehen scheint, richte ich, ein Schattenwanderer, meinen Blick auf den einsamen Pfad des Dynasten des Nichts. Ich tauche ein in die undurchdringliche Schwärze, die sein Reich umgibt, bereit, mich in den Abgründen des Vergessens zu verlieren und meinen Geist dem Zerfall preiszugeben. Und doch beobachte ich ihn auf seiner schicksalhaften Reise, die er durch das Nichts unternimmt, weit entfernt von dem Glanz seiner geliebten Schwester H’ekatee.
Ich sehe ihn durch das Nichts schreiten, ein ewiger Wanderer in der Finsternis, gepeinigt von der Sehnsucht nach seinem verlorenen Widerpart. Jede Schöpfung, die H’ekatee im Sein hervorbringt, findet ihr Widerhall im Nichts, ein schattenhaftes, grotesk verzerrtes Spiegelbild, das sich in der unendlichen Leere verliert. Der Dynast des Nichts ist dazu verdammt, seinem Schicksal zu folgen und den unermesslichen Fluss der Schöpfung auszugleichen, ohne jemals ein Teil davon zu werden.
Sein Schmerz ist tief und seine Tränen fließen wie Flüsse aus Nacht und Schatten, die das Nichts weiterhin in Dunkelheit hüllen. Im Wissen um die unermessliche Schönheit, die H’ekatee erschafft, fühlt er die Schwere seiner eigenen Unzulänglichkeit und das unerbittliche Schicksal, das ihm auferlegt wurde.
So durchstreift der Dynast des Nichts die endlosen Weiten der Einsamkeit, allein und verloren, getrieben von einer Sehnsucht, die nie gestillt werden kann. Er ist das Gegenbild zu H’ekatee, ihr Spiegelbild in der Dunkelheit, und doch ist er in seiner Tragik gefangen, unfähig, die Fesseln des Nichts zu sprengen und sich mit seiner Schwester zu vereinen. Ihre Geschichten sind auf ewig miteinander verwoben, und doch trennt sie die unüberbrückbare Distanz zwischen Sein und Nichts. Ich erhebe meine Stimme, um auch seine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte der Dunkelheit und des Schmerzes – doch noch seid ihr nicht bereit das Nichts zu ergründen, zu verstehen, zu begreifen. Geduld! Seht, wie andere Kinder H’ekatees erwachen und die Ankunft der Staubgeborenen naht. Wer weiß, welche Geheimnisse sich in den Schatten verbergen, die das Nichts zu enthüllen bereit ist? Der Vorhang wird sich heben und das Unbekannte wird sich offenbaren. Seid gewiss, das Ende ist noch nicht gekommen.

(Kapitel 9) Wilde Magie
Als Gordoron, der Gott der Magie, zum ersten Mal die Schwelle zur Astralebene überschritt, schien die Welt den Atem innezuhalten, um Zeuge seiner gewaltigen Ankunft zu werden. Mit jedem Schritt, den er auf diesem geheimnisvollen Pfad unternahm, erwachten die magischen Fäden, die diese Welt durchdrangen, und verschmolzen zu einem schimmernden Reigen aus Farben und Licht. Im Herzen der Astralebene, wo das Leuchten der Magie am intensivsten erstrahlte, errichtete Gordoron seine ewige Zuflucht. Er war sich der unaufhörlichen magischen Ströme bewusst, die sein Reich durchströmten und so begann er sein Werk – den Hain der Einsamkeit.
Er erhob seine Hände und berührte die magischen Fäden, die alles durchzogen. Behutsam streifte er die einzelnen Stränge, löste und verknüpfte sie wieder. Wie ein meisterhafter Dirigent, der ein fantastisches Orchester dirigiert, entlockte er ihnen durch zartes Zupfen die Urklänge des Seins. Die Fäden krümmten sich, fächerten sich auf, schlossen sich erneut zusammen und nahmen unter Gordorons Willen eine neue Struktur an, die von solcher Vielgestalt war, dass sie einzig von der Wahrnehmung eines Gottes erfasst werden konnte.
So formte sich sein Hain, ein Ort der Ruhe und des friedlichen Seins, umsäumt von urwüchsigen Bäumen, deren Wurzeln bis ins Herz der Astralebene reichten. Die Bäume ragten in die Unendlichkeit, ihr Laub schillerte in unzähligen Farben des magischen Lichts, und ihre Blätter erinnerten an die Seiten zeitloser Geschichten. An verschiedenen Stellen entsprangen Quellen, aus denen die wilde, ursprüngliche Magie hervorsprudelte, ihre Bäche durchzogen den gesamten Hain und trugen den Willen und die Essenz Gordorons in sich.
Im Zentrum des Hains, im Herzen der Astralebene, auf einer Lichtung, die von den Ästen der mächtigsten Bäume überschattet wurde, schuf Gordoron den ewigen Webstuhl. Aus dem magischen Gewebe der Astralebene erhob sich dieser Webstuhl, ein Meisterwerk göttlichen Schaffens, das die Kraft der Magie in sich barg. An unzähligen feinen Fäden, die wie silberne Strahlen die Finsternis durchzogen, wob Gordoron das Schicksal der Welten und der Geschöpfe, die sie bewohnten.
Sein Hain war ein Ort der Erkenntnis und der Harmonie, ein ewiger Hort für jene, die im Einklang mit der Magie wandelten, und ein Versteck für die Geheimnisse, die in den Tiefen der Astralebene verborgen lagen. Hier, im Hain der Einsamkeit, sollten Gordorons Weisheit und Magie für immer fortbestehen und eine unermessliche Inspiration für all jene bilden, die sich der Macht und dem Geheimnis der Magie widmeten.
Im Schutz dieses ehrwürdigen Bodens blühte die Magie wie nirgendwo sonst und Geschöpfe, die dem Pfad des Equilibrium folgten, fanden hier innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Gordorons Hain wurde zu einem leuchtenden Symbol der Einheit und Stärke, ein Ort, an dem sich die Mysterien der Vergangenheit und die Geheimnisse der Zukunft im ewigen Webfluss der magischen Fäden vereinten.

In den Tiefen des Hains der Einsamkeit, wo die ersten Strahlen der Dämmerung die magischen Fäden berührten, fühlte Gordoron, der Gott der Magie, dass sein Werk unvollendet war. Sein Herz sehnte sich nach einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die die Schönheit und Weisheit seiner Magie würdigen und die Gaben seines Reiches nutzen würde. So begann er mit der Erschaffung eines neuen Werkes – des Volkes der Elenornveji.
Er erhob sich von seinem ewigen Webstuhl und tauchte seine Hände in die unerschöpfliche Quelle der Magie. Meisterhaft formte er die Fäden, die das Herz und den Geist der Elenornveji bilden sollten, wob die Kraft seines eigenen Geistes und das Verständnis der wilden Magie in jeden Faden ein. Mit zärtlicher Sorgfalt wurden sie zu einem atemberaubenden Muster verflochten. Die Elenornveji wuchsen in seiner Vorstellung heran und erwachten schließlich auf den Lichtungen seines Hains.
Während sein Volk in Gordorons Hain aufwuchs und die Geheimnisse der Magie erkundete, spürte er, dass es an der Zeit war, ihnen eine besondere Lektion zu erteilen. Er wollte sie lehren, die Magie nicht nur zu verstehen, sondern auch zu lenken und zu formen. Das Wissen, dass Magie lebendig ist und als solche behandelt werden muss, wollte er ihnen vermitteln. Gordoron versammelte sein Volk um sich, und die Elenornveji lauschten gespannt der Weisheit, die ihr Schöpfer ihnen offenbaren wollte. In der Luft vor ihm begannen die magischen Fäden zu flattern und zu schwingen, und Gordoron formte sie zu einem kleinen, zierlichen Vogel. Der Vogel trug das geheime Wissen der Magie in sich, die mystischen Eigenschaften, die sich erst am Ende der Zeit offenbaren würden.
„Seht genau hin“, sagte Gordoron, während der kleine Vogel in seinen Händen flatterte. „In jedem von euch fließt Magie, so wie sie in diesem Wesen fließt. Aber es braucht Meisterschaft und Hingabe, um sie zu lenken und ihre Macht zu nutzen.“ Fasziniert beobachteten die Elenornveji, wie Gordoron den kleinen Vogel in die Lüfte entließ. Der Vogel schwebte über ihnen und begann, seine Flügel im Rhythmus der magischen Fäden zu bewegen. Die Magie in jedem der Elenornveji erwachte zum Leben und sie begannen, ihn nach ihrem Willen zu formen und zu lenken. Der kleine Vogel flog weiter durch den Hain, von einer Lichtung zur nächsten, immer im Einklang mit den unsichtbaren Fäden der Magie. Die Elenornveji verstanden nun, dass dieser mystische Vogel ein Geschenk und ein Lehrer zugleich war, ein ewiger Begleiter auf ihrem Weg, der sie daran erinnerte, die Magie in sich selbst und in der Welt um sie herum zu schätzen und zu ehren.
So wurde der kleine Vogel, den Gordoron erschuf, zu einem Symbol der Weisheit und der Magie, das die Elenornveji auf ihrem Weg begleitete. Seine mystischen Eigenschaften, die am Ende der Zeit enthüllt werden sollten, blieben ein Rätsel – ein Geheimnis, das tief in den Fäden des Schicksals verborgen lag und das die Elenornveji eines fernen Tages zusammen mit ihrem Schöpfer enthüllen würden.
Das Volk Gordorons wandelte durch den Hain der Einsamkeit und ergründete die Mysterien der Wirklichkeit. Es wuchs in der Meisterschaft der Magie und lernte, die verborgenen Muster des Kosmos zu erkennen und die Geheimnisse des Schicksals zu enträtseln. Das Leben und Wirken der Elenornveji verband sich untrennbar mit dem göttlichen Webstuhl ihres Schöpfers, und sie wurden zu ewigen Zeugen und Hütern der Magie, die ihr Vater in alle Welten gesandt hatte. Sie waren eine lebendige Erweiterung seines Hains, eine Widerspiegelung der Magie und Weisheit, die in jeder Faser der Astralebene schlummerte. Die Elenornveji gingen ihren Weg und webten mit ihren Händen die magischen Fäden der Vorsehung, immer begleitet von dem mystischen Vogel, der sie in der Kunst der Magie unterwies.
In den Tiefen des Hains der Einsamkeit, wo Gordorons Magie und Weisheit die Welt durchdrangen, wuchs eine Gemeinschaft heran, die die Schönheit und Vielfalt seiner Schöpfung würdigte und die Gaben seines Reiches nutzte. Das Volk Gordorons wurde zu einem leuchtenden Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn Herz und Verstand im Einklang mit der Magie vereint sind und wie der göttliche Funke, der allem innewohnt, die Welt in unendlicher Schönheit und Weisheit erstrahlen lassen kann.
(Kapitel 10) Die Vergänglichkeit des Lebens
Einst, als die Welt noch jung war und die Staubgeborenen noch fern, da bevölkerten die Tiere das Land und in den Schatten ihrer Welt schlummerte die Weisheit der Alten. Verborgen lag das Reich des Todes, und kein Wesen außer Oropher und seinem Volk kannte die Geheimnisse, die es barg.
Es geschah an einem Tage, als die Sonne ihr goldenes Antlitz über die Welt ergoss und die Lüfte vom Duft der Blumen erfüllt waren, dass ein seltsames Geschöpf die Fluren der Lüfte durchschnitt. Seine Schwingen waren schwarz wie Rabenfedern, sein Leib in des Laubes Flüstern gehüllt, das wie der Nachthimmel glomm. Das Wesen flog herab und schwebte in der Nähe einer großen Eiche, auf deren Ast eine weiße Eule das Geschehen beobachtete. Ihre Federn waren sanft wie der Schnee, der im Winter fällt, und ihre Augen tief wie das Eis, das die Seen bedeckt.
Das Geschöpf sprach, und seine Stimme war unergründlich wie das Rauschen der Blätter im Wind: „Höre mich, Geschöpf dieser Welt, denn ich komme zu dir mit einer Botschaft von großer Bedeutung. Ich bin ein Gesandter und Teil des Volkes von Oropher und ich bin hier, um euch etwas zu verkünden. Eure Welt ist schön und voller Leben, aber ihr müsst wissen, dass der Tod ein notwendiger Teil des ewigen Kreislaufs ist, denn wo es keinen Tod gibt, kann auch kein Leben sein. Berate dich mit den deinen, denn Oropher, der Hüter des letzten Mysteriums, legt die Entscheidung darüber, wen der Tod ereilen soll, in eure Pfoten.“

Die weiße Eule, von der Botschaft tief ergriffen, erhob sich in die Lüfte und flog, bis sie den höchsten Ast eines uralten Baumes erreichte, der wie ein Wächter in der Mitte der Welt stand. Sie rief die Tiere um sich, und sie kamen, neugierig und erfüllt von Ehrfurcht. Die Eule erzählte ihnen von der Botschaft, die ihr überbracht worden war, und die Tiere lauschten, ihre Augen erfüllt von Furcht und Staunen. Sie verstanden, dass die Botschaft wichtig war, aber sie wussten nicht, wie sie den Tod in ihre friedliche Welt einbringen sollten.
Um diese Fragen zu beantworten, beschloss die weiße Eule, den Rat der klügsten und weisesten Tiere der Welt einzuholen. Sie wandte sich an den Bären, den Fuchs, die Schildkröte und den Biber, die sie alle um sich versammelte und sie bat, ihr bei dieser schwierigen Aufgabe zu helfen. Die klugen Tiere trafen sich mit der weißen Eule im geheimen Hain, wo die Bäume älter als die Zeit selbst zu sein schienen. Hier, im Herzen der Natur, hofften sie, gemeinsam eine Lösung zu finden, um den Tod in ihre Welt zu integrieren, ohne dabei das Gleichgewicht und die Harmonie ihrer Existenz zu stören.
Zuerst erhob der mächtige Bär seine Stimme, dessen Kraft und Weisheit in seiner Brust wie ein uralter Berg grollte: „Ich schlage vor, dass wir den Tod den Alten und Schwachen bringen. So werden sie in Frieden ruhen und ihre Kraft an die Jüngeren weitergeben, die sie benötigen, um unsere Welt zu erhalten.“
Daraufhin sprach der schlaue Fuchs, dessen Worte wie der Wind durch die Bäume glitten: „Aber sollten wir nicht auch jene bedenken, die unter Qualen und Krankheiten leiden? Der Tod kann eine Gnade sein, ein Ende der Schmerzen und die Seele kann sich in den ewigen Fluren des Jenseits erholen.“
Die weise Schildkröte, deren Geduld und Einsicht so alt wie die Erde selbst war, erhob ihr Haupt und sagte: „Wir müssen auch die natürliche Ordnung in Betracht ziehen. Wenn das Leben ohne den Tod weiterginge, gäbe es kein Gleichgewicht mehr. Wir müssen dem Tod seinen Platz im ewigen Kreislauf zugestehen, damit das Leben weiter gedeihen kann.“
Zuletzt sprach der fleißige Biber, dessen Tatkraft die Welt formte und gestaltete: „Wir müssen sicherstellen, dass wir den Tod mit Respekt und Achtung behandeln. Wenn wir den Tod als Teil des Lebens akzeptieren, werden wir lernen, jeden Moment zu schätzen und die Weisheit der Vergänglichkeit zu erkennen. Jene, die unverhofft gehen müssen, sollen den Anderen eine stete Erinnerung daran sein, dass jeder Augenblick lebenswert ist.“
Die Schneeeule lauschte den Worten und erkannte, dass die klugen Tiere in ihrer Weisheit eine Antwort gefunden hatten, wie sie den Tod in ihre Welt integrieren würden.
Bär, Fuchs, Schildkröte und Biber kamen überein, dass der Tod den Alten, Schwachen, Leidenden und jenen, die bereit waren, ihren Platz im ewigen Kreislauf freizugeben, gebracht werden sollte. Sie würden den Tod mit Achtung und Ehrfurcht behandeln und ihn auch als unverhofften Gast willkommen heißen.
Die weiße Eule überbrachte dem Gesandten Orophers die Entscheidung der Tiere, und das Geschöpf nickte zustimmend. „Ihr habt weise gewählt“, sprach es, „und eure Entscheidung, wird der Beginn eines Kreislaufs sein, der Leben und Tod im Gleichgewicht untrennbar miteinander verbindet. Oropher wird eure Wahl respektieren. Eure Seelen sollen in den Fluren des Jenseits, die von Oropher und seinem Volk bewacht werden, in Frieden ruhen.“
Von da an lebten die Tiere in der Erkenntnis, dass der Tod ein notwendiger Teil des Lebens war, und sie lernten, jeden Moment zu schätzen und die Weisheit der Vergänglichkeit zu erkennen. In den Schatten ihrer Welt schlummerte die Weisheit der Alten, und das Gleichgewicht der Welt wurde bewahrt, so wie es von Anbeginn der Zeit vorgesehen war.
(Kapitel 11) Die schlafende Göttin
Ich blicke in die Finsternis, in den Mahlstrom der Zeit und aller Wahrheiten. Meine Augen sind aufgerissen, aber ich kann nichts sehen, nur Schwärze, bedrückende Finsternis, die sich gegen meinen Geist stemmt, ihn zerquetschen möchte wie einen unerwünschten Gast, der sich Zutritt erschlichen hat, ohne willkommen zu sein. Ich höre ein Knistern, ohrenbetäubende Schläge, die sich wie glühende Eisen durch mein Gehör in meinen Geist bohren. Es bereitet mir Qualen, aber ich ertrage sie. Langsam hebt sich der Schleier, gibt den Blick frei auf etwas, was gewesen sein könnte, etwas, das nicht sein durfte. In der Unendlichkeit des Kosmos, dort wo Zeit und Raum verschwimmen, ruht Taranida, die schlafende Göttin des Krieges. Obgleich sie in ihrem tiefen Schlaf verharrt, ist sie allgegenwärtig und wacht über die Geschicke und Ereignisse der Welten. Ihre Essenz durchdringt alle Reiche, stets bereit einzugreifen und das endgültige Urteil zu vollstrecken. Als H’ekatee, die große Göttermutter, alles was war, ist und sein könnte in ihrem unendlichen Geist ersann, streifte sie die Ahnung eines möglichen Pfades, der als mahnendes Gleichnis dienen soll.
In den Tiefen der Katakomben, in die das Licht nur zögerlich hinein sickert, warteten die Naur’Padha, Krieger von unermesslicher Stärke und Entschlossenheit, bereit für den Kampf, der ihrem Leben Sinn verlieh. Im Wissen um das Vermächtnis ihrer Göttin, die sie aus den Splittern ihrer in den Feuern der Ewigkeit geschmiedeten Rüstung erschaffen, waren sie die personifizierte Ehre und der Wille für Gerechtigkeit und Frieden zu kämpfen, auch wenn es den höchsten Preis forderte.

Es war einmal eine Stadt, in der das Leben pulsierte und Lachen und Freude allgegenwärtig waren. Doch finstere Mächte, getrieben von Habgier und Neid, hatten sich der Stadt bemächtigt und Schatten über die einst strahlenden Mauern geworfen. So erhob sich der Schrei der verzweifelten Seelen, und Taranida, obgleich schlafend, vernahm ihn.
In dieser Zeit der Dunkelheit und des Schmerzes endete das Warten der Naur’Padha und sie machten sich auf, das Leid zu lindern und die Finsternis zurückzudrängen. Sie kämpften tapfer und ehrenhaft, doch die Schatten waren stark und ergossen sich wie eine unersättliche Flut über die Welt. Die Naur’Padha sahen ihre Reihen mit jedem Tag dünner werden und in ihren Herzen wuchs die Verzweiflung. In den Nächten, wenn die Sterne am dunklen Himmel funkelten und der Mond seine silberne Gabe über das Land ergoss, knieten die Naur’Padha nieder und beteten zu ihrer schlafenden Göttin. Sie flehten sie an, ihnen die Kraft und den Mut zu geben, die sie benötigten, um die Fluten der Finsternis aufzuhalten. Doch Taranida schlief weiter und die Welt schien dem Untergang geweiht.
Als die letzte Schlacht bevorstand und das Schicksal der Welt auf Messers Schneide stand, ertönte plötzlich ein Donnerschlag, der die Erde erzittern ließ. Mit einem gewaltigen Beben erwachte Taranida aus ihrem Schlaf, und ihr majestätisches Antlitz strahlte wie die aufgehende Aurora. Ihre flammenden Augen durchdrangen die Dunkelheit und offenbarten die wahre Natur der Finsternis, die das Land in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Die Göttin des Krieges erhob sich in ihrer schrecklichen Pracht, und ihre mächtige Stimme donnerte durch die Lüfte: „Ich erwache, um die letzte Schlacht zu entscheiden, und mein Urteil wird über allem stehen. Die Finsternis wird vor meiner Gerechtigkeit erzittern, und die Welt wird von ihrem Schatten befreit werden.“ Sie schwebte über das Schlachtfeld, und ein einziger Blick genügte, um das pochende Herz eines jeden Kriegers zum Stillstand zu bringen. Sie richtete über Freund und Feind, blickte unverstellt in alle Herzen, erkannte die Last der angehäuften Schuld und niemand entging ihrem Urteil. In ihrer unbändigen Macht offenbarte sie die Schrecken des Krieges in all ihrer Grausamkeit, den bitteren Hoffnungsschimmer eines solchen Zustandes, das trügerische Versprechen von Gerechtigkeit und Frieden, das den geforderten Tribut wert ist.
Taranida betrat das Schlachtfeld und die Erde erbebte erneut. Die Brut floh vor ihrer göttlichen Präsenz und wurde zurückgedrängt. Mit jedem ihrer Schritte entfachte die Göttin ein Feuer der Hoffnung in den Herzen ihrer Kinder, der Naur’Padha, und säte Verzweiflung in den Köpfen der anderen. Als sie der Macht, die das Land verdorben hatte, entgegentrat, schmiedete sie aus ihrem inneren göttlichen Zorn eine mächtige Waffe – ein Schwert, das funkelte wie die Sterne selbst und die Macht besaß, alles zu zerschmettern.
Die Schlacht war von infernalischer Wut erfüllt und das Land erbebte unter dem Zorn der Göttin. Taranida schwang ihr strahlendes Schwert und zerschnitt die Heerscharen, die sich ihr entgegenstellten. Ihre Gerechtigkeit war gnadenlos, aber auch voller Liebe für ihre Kinder und die Welt, die sie beschützen wollte. Mit jedem vernichtenden Hieb befreite sie die Seelen der Gefallenen, die von der Dunkelheit verschlungen worden waren und schenkte ihnen Frieden.
Der Kampf dauerte viele Tage und Nächte, bis die Finsternis besiegt und die Welt von ihrem schrecklichen Einfluss befreit war. Doch die Kriegsgöttin war entfesselt und richtete alles und jeden und die ganze Welt. Als sie fertig war, blieb nur Verwüstung zurück, verbranntes Land und eine Träne. Langsam floss diese die Wange der Göttermutter hinunter und tropfte in die Unendlichkeit, die sich unter ihr befand. Sie lächelte.
Die Geschichte der schlafenden Göttin ist eine Mahnung und ein Gleichnis, das mich lehrt, dass wir die Folgen unseres Handelns bedenken und Verantwortung für unser Schicksal und das unserer Welt übernehmen müssen. Denn nur wenn wir uns unserer eigenen Kraft bewusst sind und im Einklang mit den Göttern und der Natur leben, können wir das Gleichgewicht bewahren und den Schatten der Dunkelheit Einhalt gebieten. Nur dann wird Taranida, die Göttin des Krieges, in ihrem ewigen Schlaf verharren und der Welt den Frieden lassen.
(Kapitel 12) Mentrons Sehnsucht
Mentron erwachte mit einem Lächeln auf seinen vollen Lippen, das Licht der staubgeborenen Welt durchdrang seine feinen Lider und tauchte seine Umgebung in einen samtigen, warmen Schein. Als er seine klaren, betörend himmelblauen Augen öffnete, summte alles Sein eine zarte Serenade der Sehnsucht. Er war der jüngste unter den Kindern H’ekatees, Gott der Gefühle, Wünsche und Absichten. Seine Gestalt war androgyn, zerbrechlich und stark zugleich, und sein Wesen so betörend, dass alles und jeder sich sofort zu ihm hingezogen fühlte, weil er das geheime, innewohnende Begehren verkörperte.
Mentron räkelte sich und streckte seine Glieder aus, betrachtete seine Hände und hielt sie vor Calans Glanz, erhob sich und begann die Welt der künftigen Staubgeborenen zu erkunden. Seine sanften Schritte hinterließen kaum eine Spur im feinen Staub, der ihn umgab, während er sich geschmeidig fortbewegte. Mit jedem Schritt lernte er seine Kräfte kennen, er entdeckte sie, meisterte sie in Windeseile, spürte sie durch seine Adern pulsieren, eine unerschöpfliche Fontäne der Erregung, eine Quelle der Muse und des hemmungslosen Impulses. Er war bereit und willens, die Gefühle aller Wesen zu lenken und zu formen. Doch Mentron fühlte sich nutzlos und ohne Aufgabe, denn die anderen Götterkinder hatten ihre Berufung und Bestimmung schon längst gefunden, während die Staubgeborenen noch nicht erschienen waren. Seiner Bestimmung konnte er ohne jene Wesen, die noch folgen sollten nicht nachgehen, sie nicht erfüllen. Er hungerte nach einer Berufung, einer Bestimmung, für die er seine unendliche Macht einbringen durfte. Von diesem unstillbaren Verlangen getrieben, erschuf Mentron sein Volk, die Lilhavior, Bewahrer des Gleichklangs unter den Emotionen und mit der Freiheit gesegnet, ihm bedingungslos dienen zu dürfen. Sie waren beispiellos in ihrer Macht, Meister der Beeinflussung, wie man sie nie wieder antreffen sollte. Sanfte Wesenheiten voller Anmut und Finesse. Ein jeder ausgestattet mit einem Spiegel, der in der Lage war, das größte Verlangen aufzudecken und mit allen Anderen Spiegeln und dem Gott der Gefühle selbst verbunden war. Die Lilhavior verehrten und huldigten Mentron, richteten zu seinen Ehren ausschweifende Feste aus und vergötterten ihn bedingungslos bis zur Selbstaufopferung, doch schon bald verspürte ihr Meister erneut Langeweile und eine tiefe Unzufriedenheit in seinem Herzen.

Lavok, sein älterer Bruder und Gott der Träume, erkannte das Begehren in Mentron und begann Intrigen zu spinnen. Er flüsterte ihm ein, dass die anderen Götter ihn als den größten unter den untätigen Göttern verspotteten, und Mentrons Herz wurde schwer vor Gram und Bitterkeit. Der Herr der Träume wurde nicht müde, seinem Bruder von der großen Macht der anderen Götterkinder zu erzählen. Immer wieder erwähnte er auch die überragende Macht ihrer Schwester Taranida, die als die gewaltigste unter den Kindern H’ekatees galt. Die Worte seines Bruders schürten nach und nach Zwietracht zwischen ihnen, und es kam zum Streit, der in einer infernalischen Auseinandersetzung gipfelte. Der Kampf zwischen Mentron und Lavok fand in der Welt der Träume statt. Hier war Lavok in seinem Reich und er nutzte seine Macht, um die Welt ringsum zu formen und zu beherrschen. Mentron, in blindem Zorn versunken, trat entschlossen ein und stellte sich seinem Bruder.
Dieser erwartete ihn bereits und breitete seine Arme aus, sodass eine Arena sichtbar wurde, die aus den Träumen der Vergessenen geformt worden war. Eine endlose Landschaft, ständig in Bewegung, durch die Zeiten springend, wie ein lebendiger, sich windender Leib. Der Boden unter ihren Füßen bebte, als schwebende Inseln, schroffe Klippen und verwitterte Ruinen aus dem Nebel des Traumes auftauchten und wieder verschwanden.
Mentron holte zum ersten Schlag aus und setzte seine unübertroffenen Beeinflussungskünste ein, um Lavok in seinem innersten Selbst anzugreifen. Er erzeugte wallende Wogen der Furcht, des Zorns und der Verzweiflung, die wie eine Sturzflut über seinen Bruder hereinbrachen. Lavok mühte sich vergeblich, auszuweichen, wurde getroffen und stolperte zurück, überwältigt von der Macht der Gefühle, doch er hielt stand, indem er seine Träume zu einer Barriere formte, die Mentrons Angriffe abfingen und sich selbst in den Kern seiner ewigen Existenz zurückzog. Die beiden Götter prallten aufeinander und ihre Kräfte verschmolzen in einem wilden Tanz aus Licht und Schatten, Emotionen und Träumen. Lavok manipulierte die Welt um sie herum, schuf gefährliche Situationen und tödliche Fallstricke, einen Hagel aus splitternden Knochen, eine Säurewolke, die ihre Haut zu verätzen drohte und ein Labyrinth aus gellenden Schreien, das sich stetig veränderte und ihnen den Durchgang verstellte. Dennoch ließ sich Mentron nicht beirren. Er drängte seinen Bruder zurück, beeinflusste seine Gefühle, verwandelte seinen Zorn in Verzweiflung und seine Entschlossenheit in Hadern. Lavok widersetzte sich und versuchte, seine Gedanken und Gefühle unter Kontrolle zu halten, während er gleichzeitig Mentron mit seinen Traumgebilden zu überwältigen suchte.
Die Heftigkeit des Ringens war bisher ohnegleichen. Jeder Schlag, den die beiden Götter austauschten, erschütterte die Traumwelt und ließ sie in ihren Grundfesten erzittern. Gnadenlos gingen sie aufeinander los, getrieben von der unbändigen Kraft ihres Bruderstreites. Als der Kampf seinen Höhepunkt erreichte, erkannten Mentron und Lavok, dass sie in ihrer Verbissenheit nicht gewinnen konnten. Erschöpft und verwundet starrten sie einander an, die Erkenntnis dämmerte in ihren Augen, dass ihre Kräfte ebenbürtig waren und sie sich gegenseitig auslöschen würden, wenn sie so weitermachten.
Schließlich war es der Gott der Träume, der dem Kampf ein Ende setzte. Erschöpft und am Ende seiner Kräfte brach er die Auseinandersetzung gnädig ab und gab sich geschlagen. Mit freundlichen Worten beschwichtigte er seinen Bruder Mentron, der nicht erkannte, dass Lavok in Wirklichkeit zu einem letzten Angriff ansetzte. Er pflanzte dem Gott der Gefühle ein Traumbild in den Kopf, das tief in seinem Herzen Wurzeln schlug: Mentron war der Primus unter den Göttern, unerreichbar schillernd in seiner Macht, Herr der Gefühle, Wünsche und Absichten, Bewahrer des Friedens und Bringer des finalen Urteils. Dieses Traumbild weckte in ihm eine unstillbare Sehnsucht, ein gnadenloses Verlangen, das sich zu blindem Neid steigerte. Mentrons himmelblaue Augen leuchteten in einem intensiven Giftgrün.
Als Mentron seinen neuen Wunsch und seine aufkeimende Besessenheit betrachtete, erschien ihm ein Schmetterling, der sich sanft auf seiner Schulter niederließ und ihm mit der Stimme der Göttermutter H’ekatee zuflüsterte, er solle sich von diesem Gedanken befreien. Mentron schloss die Augen und ging in sich, spürte die Wärme der Göttermutter um sich und versuchte, den verderblichen Wunsch zu verscheuchen. Doch die Saat war bereits gelegt und stark. Sie schlummerte im Verborgenen und harrte darauf, zu keimen und aufzugehen.
Tage und Nächte zogen ins Land und Mentron wandelte rastlos über das Antlitz der Welt. Er versuchte, sich auf seine Aufgabe vorzubereiten, die Emotionen der sterblichen Wesen zu lenken und zu formen, doch das verborgene Verlangen, das Lavok in ihm geweckt hatte, nagte unaufhörlich an ihm. Er ertränkte seine Sorgen in ausschweifenden Festen und beispiellosen Exzessen, doch die dunkle Wolke des Neides bedeckte sein Herz und ließ ihn keine Ruhe finden. Er musste mächtiger werden als alle anderen Götterkinder, und so fasste er einen Plan, der schreckliche Folgen haben sollte.
Von ihrem Herrn angetrieben, flüsterten die Lilhavior, Mentrons treue Diener, Unruhe und Zweifel in die Herzen der Völker. Sie säten Missgunst und ernteten Vorbehalte. Ließen Freundschaften verdorren und Feindschaften aufkeimen. Obwohl sie spürten, dass sich etwas in Mentron verändert hatte, folgten sie seinem Wunsch, wenngleich es bedeutete, die Welt, in der sie lebten und deren Einklang sie zu bewahren geschworen hatten, ins Chaos zu stürzen.
Eines Tages, als Mentron am Rande einer Klippe stand und in die unendliche Weite der Welt blickte, die er mit seinen Kräften beeinflussen konnte, bemerkte er einen einzelnen Schmetterling, der über das Wasser flatterte und sich dem Ufer näherte. In seinem Flügelschlag erkannte er die Stimme der Göttermutter und öffnete sein Herz für ihre Worte.
„Mentron, mein liebstes Kind“, sprach H’ekatee sanft, „du musst die Dunkelheit in dir erkennen und besiegen, bevor sie dich und die Welt, die du liebst, verschlingt. Nur du allein hast die Macht, das Gleichgewicht der Gefühle wiederherzustellen und Frieden zu finden. Du bist ein Teil von mir. Ich kenne die verschiedenen Wege, die vor dir liegen, und der Weg, den du gewählt hast, führt zu unermesslichem Leid. Kehre um, mein Kind, das ist meine erste und letzte Warnung.“
Mit diesen mahnenden Worten verschwand der Schmetterling und Mentron stand allein an der Klippe. Die Worte der Göttermutter hallten in seinem Geist wider, und er wusste, dass er sich seiner eigenen Dunkelheit stellen musste, um seine Bestimmung zu erfüllen und das Gleichgewicht der Gefühle wiederherzustellen.
Und so begann Mentron eine innere Reise, um die Quelle seines Neides und seiner Unzufriedenheit aufzudecken. Er stellte sich den unheilvollen Einflüssen in seinem Herzen und kämpfte gegen sie, um wieder Herr über seine Gefühle und seine Bestimmung zu werden. Es war ein langer und harter Weg, aber schließlich gelang es Mentron, den grünen Schleier des Neides zu durchdringen und seine wahre Natur als Gott der Gefühle freizulegen. Doch er hatte einen winzigen Funkelfleck übersehen, einen flüchtigen Schimmer, der vom Glanz der Zuversicht überdeckt wurde.
In der Welt der Staubgeborenen spürten die Lilhavior die Veränderung, die sich in Mentron und damit auch in ihnen vollzog. Sie hofften, dass der Gott der Gefühle sein Schicksal erfüllen und Harmonie in ihre Herzen bringen würde. Als Mentron schließlich seine innere Unruhe besiegte und das Gleichgewicht der Gefühle wiederherstellte, kehrte Ruhe in die Welt ein. Die Lilhavior, erleichtert und stolz auf ihren Schöpfer, setzten ihre Bemühungen fort, den Einklang der Gefühle zu bewahren.
Und so fand Mentron vorübergehend seinen vermeintlichen Platz in der Welt, seine Sehnsucht gestillt und seine wahre Bestimmung gefunden. Doch auch ein kleiner Fleck, so blass und winzig er auch erscheinen mag, kann wieder größer werden und sich unbemerkt ausbreiten. Der Herr der Träume handelt nie unbedacht und er wusste – die Zeit würde alles richten.
(Kapitel 13) Die Serenade des Nebelraben
Fortsetzung folgt …